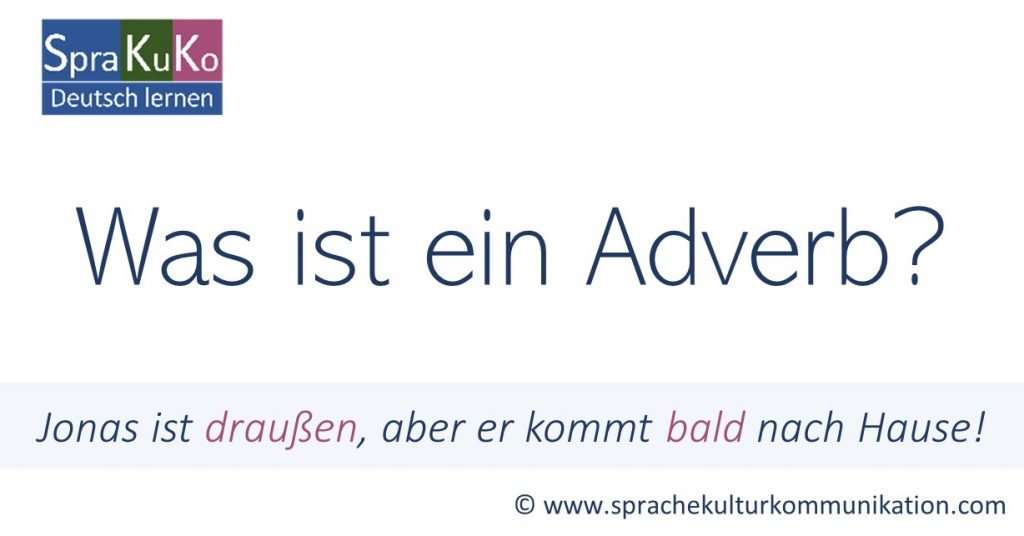
Was ist ein Adverb?
Ein Adverb ist eine Wortart, mit der man Informationen über den Ort, die Zeit, die Art und Weise oder den Grund geben kann. Ein Adverb wird auch als Umstandswort bezeichnet und spielt eine wichtige Rolle in der Satzstruktur, indem es adverbiale Bestimmungen liefert und sich als einzelne Wörter oder in größeren Adverbphrasen präsentiert. Darüber hinaus gebraucht man Adverbien, um Präpositionalergänzungen zu ersetzen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Adverbien auf Vorerwähntes oder Nachfolgendes. Ein Adverb ist nicht flektierbar und gehört somit zur Klasse der unflektierbaren Wortarten. Adverbien können aus Adjektiven abgeleitet werden, wobei sie die grammatikalischen Funktionen beider Wortarten verdeutlichen und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten betonen. Im Gegensatz zur Präposition, Konjunktion und Partikel kann ein Adverb alleine das Vorfeld, die Position vor dem finiten Verb, besetzen.
Welche Adverbien gibt es?
Adverbien kann man nach ihrer Bedeutung in verschiedene Subtypen einteilen. Die Einteilung der Adverbien erfolgt nach ihrer Bedeutung und Funktion in zwei Subklassen. Zunächst werden Adverbien angeführt, die temporale, modalen, kausale und lokale Informationen liefern und häufig eine selbstständige Bedeutung haben. Anschließend widmen wir uns Adverbien, die ausschließlich unter Einbezug von Kontextwissen verstanden werden können. Beachten Sie, dass im Sinne der Übersichtlichkeit unter jeder Klasse (Temporal-, Kausal-, Modaladverbial, etc.) alle Adverbien aufgelistet sind und keine Differenzierung zwischen autonomer (z.B. abends, heute) einerseits und situations- und kontextgebundener (z.B. damals, seither) andererseits vorgenommen wird.
Temporaladverbien
Temporaladverbien dienen dazu, Informationen über einen Zeitpunkt oder Zeitraum oder die Dauer von etwas zu geben. Man kann mit Fragewörtern wie z.B. Wann? Wie lange? Wie oft? nach ihnen fragen.
abends, anfangs, bald, bisher, bislang, damals, dann, demnächst, eben, endlich, eher, früh, gerade, gleich, häufig, heute, heutzutage, immer, jährlich, jederzeit, jetzt, lange, längst, inzwischen, jährlich, jetzt, mehrmals, manchmal, mittags, monatlich, morgen, nachmittags, nachher, nachts, neulich, nie, niemals, noch, nochmals, nun, oft, schließlich, seither, seitdem, selten, soeben, stets, täglich, übermorgen, vorerst, vorgestern, vorher, vorhin, vormittags, wann, wiederum, wöchentlich, zuerst, zuletzt, zunächst
Kausaladverbien
Kausaladverbien geben nähere Informationen über einen Grund oder eine Folge.
Man kann mit den Fragewörtern Warum? oder Wozu? nach ihnen fragen.
also, darum, deshalb, deswegen, nämlich, vorsichtshalber
Modaladverbien
Modaladverbien dienen zum Ausdruck der Art und Weise eines Geschehens.
Man kann mit dem Fragewort Wie? nach ihnen fragen.
anders, besonders, einigermaßen, ganz, gern, größtenteils, halbwegs, irgendwie, leider, möglicherweise, so, teilweise, überaus, überhaupt, vermutlich, vielleicht, wahrscheinlich, ziemlich, zudem
Lokaladverbien
Lokaladverbien, auch bekannt als Adverbien des Ortes, geben einen Ort, eine Richtung oder ein Ziel an. Diese Adverbien machen Ortsangaben und können mit Fragewörtern wie z.B. Wo? Woher? oder Wohin? identifiziert werden.
abwärts, aufwärts, außen, da, daher, dahin, dort, dorther, dorthin, draußen, drinnen, drüben, geradeaus, herein, herauf, heraus, herunter, herüber, hier, hierher, hierhin, hinauf, hinaus, hinein, hinten, hinunter, hinüber, innen, links, nirgendwo, oben, rechts, rückwärts, überall, unten, vorn, vorwärts
Pronominaladverbien
Als Pronominaladverbien werden Wortzusammensetzungen bezeichnet, die aus einem Adverb und einer Präposition bestehen. Ihrer Form nach bezeichnet man sie häufig als Präpositionaladverbien. Unter Berücksichtigung der Funktion ist die Bezeichnung „Pronominaladverb“ sinnvoll, um zu zeigen, dass sie eine Stellvertreterfunktion ausüben und eine Präpositionalphrase ersetzen. Die Funktion, Teile eine Äußerung zu ersetzen, ist auch bei den folgenden Subkategorien (Konjunktional-, Frage- und Relativadverbien) gegeben.
dabei, dafür, damit, darüber, dazu
Konjunktionaladverbien
Konjunktionaladverbien verfügen über Eigenschaften von Konjunktionen und Adverbien. Sie können im Vorfeld als auch im Mittelfeld des Satzes stehen und weisen somit Eigenschaften von Adverbien auf. Da sie am Satzanfang die Funktion einer Konjunktion übernehmen können, bezeichnet man die folgenden Adverbien als Konjunktionaladverbien.
allerdings, also, außerdem, daher, dagegen, damit, demnach, demzufolge, deshalb, deswegen, ebenso, ferner, folglich, insofern, indessen, nämlich, so, somit, stattdessen, trotzdem, vielmehr, währenddessen, weiter, zudem
Konjunktionaladverb vs. Konjunktion
Im Unterschied zu den Konjunktionen können Konjunktionaladverbien das Vorfeld vor dem finiten Verb allein besetzen und im Mittelfeld des Satzes auftreten.
Frageadverbien
Frageadverbien dienen zum Ausdruck von Ergänzungsfragen. In diesem Kontext stehen sie an der ersten Position im Satz.
wann, warum, wie, wie viel, weshalb, wo, woher, wohin
mit Präpositionen: wodurch, womit, woran, worauf, woraus, worunter, worüber, wovon, wozu
Relativadverbien
Relativadverbien leiten einen Relativsatz ein. Die Formen überschneiden sich mit denen der Interrogativadverbien, jedoch unterscheiden sie sich in ihrer Funktion. Relativadverbien beziehen sich auf ein vorangegangenes Element im Äußerungskontext. Dabei wird ein kausaler, modaler oder lokaler Bezug hergestellt. Auch temporale Adverbien können einen Nebensatz einleiten, jedoch zählen sie zu den Interrogativadverbien.
kausale Relativadverbien: weshalb, weswegen, wieso
modale Relativadverbien: wie
lokale Relativadverbien: wo, woher, wohin, woran
Adverb vs. Adjektiv vs. Adverbial
Häufig werden syntaktische Kategorien und Funktionen miteinander vermischt. Adverbien und Adjektive können als Adverbiale (syntaktische Funktion) gebraucht werden. Jedoch sind Adverbien und Adjektive zwei verschiedene Wortarten (syntaktische Kategorien). Adjektive sind flektierbar und komparierbar, Adverbien jedoch nicht.
1) Die morgige Veranstaltung fällt aus. (attributives Adjektiv)
2) Die Veranstaltung findet morgen nicht statt. (Adverb)
3) Die Veranstalter verteilen fleißig Gutscheine. (Adjektiv in adverbialer Funktion)
Stellung von Adverbien im Satz
Die Stellung von Adverbien im Satz kann im Deutschen variieren und ist oft flexibel.
Adverbien können am Satzanfang stehen, was häufig die Betonung auf das Adverb legt: “Morgen gehe ich einkaufen.”
Sie können auch in der Mitte des Satzes stehen, direkt nach dem konjugierten Verb: “Ich gehe morgen einkaufen.”
In zusammengesetzten Sätzen können Adverbien zwischen dem konjugierten Verb und dem Partizip Perfekt stehen: “Ich habe gestern einen Film gesehen.”
Die Position des Adverbs kann die Bedeutung und den Fokus des Satzes verändern, daher ist es wichtig, die Stellung bewusst zu wählen.
